Ein Buch über Rudolf Steiner und die Anthroposophie,
das auch deren Verächtern Bedenkenswertes zu sagen hat
Rüdiger Safranski
von Michael Mentzel
Vorab gesagt, dieses Buch ist ein Buch für Menschen, die vielleicht noch nie Berührung mit der Anthroposophie hatten, andererseits aber auch eines für Zeitgenossen, die sich schon seit Jahren mit den Ideen und dem Kosmos Rudolf Steiners auf die eine oder andere Weise auseinandersetzen. Erschienen ist dieses Buch nicht in einem genuin anthroposophischen Verlag, sondern im renommierten Kröner-Verlag. Der Autor ist kein Unbekannter, Wolfgang Müller hat sich bereits auf vielfältige Weise mit dem Thema Anthroposophie beschäftigt, neben Artikeln in der Taz oder der Zeit sowie in anthroposophischen Publikationen wie der Info3 oder dem Wochenblatt Das Goetheanum. Nun also "Das Rätsel Rudolf Steiner – Irritation und Inspiration". Zu Beginn schildert der Autor seine ersten persönlichen Begegnungen mit der Anthroposophie und gibt einen kurzen Einblick in die dann folgenden acht Kapitel, von denen das erste mit der Frage: "Was ist der Kern der Anthroposophie" aufwartet und das der Autor mit "Dreister Versuch einer Kurzfassung" überschreibt.
Dass es ihm um mehr geht als nur die Beschreibung einer alternativen Lebensgestaltung, wird schon zu Beginn deutlich: "…es ist schon wahr, die Anthroposophie enthält auch einen Zug der Dringlichkeit, ein Gespür dafür, das unsere scheinbar so aktive und wache Epoche im Entscheidenden schläft." Dieser Gedanke und die sich daraus ergebenen Schlussfolgerungen durchziehen die folgenden Kapitel und ermöglichen den Leserinnen und Lesern des Buches die Möglichkeit eines vertieften Verständnisses der Anthroposophie und der Gedankenwelt Rudolf Steiners. "Ich muss nicht behaupten, dass Rudolf Steiner ein perfekter Mensch war, um doch zu behaupten, dass er unserer Zeit Bedeutendes zu sagen hat", so Wolfgang Müller und es wird sich im weiteren Verlauf zeigen, das der Titel des Buches auch "Rudolf Steiner verstehen" hätte heißen können.
Was ist eigentlich dieser Erkenntnisweg der Anthroposophie, der das "Geistige im Menschenwesen", das Rudolf Steiner in seinen "anthroposophischen Leitsätzen" anspricht und der zum "Geistigen im Weltenall" führen möchte? So mancher Zeitgenosse wird hier bereits die Stirn runzeln, denn wie der Autor wohl nicht zu Unrecht bemerkt, erscheint dieser Begriff (des Geistigen) heute "vielen als fragwürdig". Seine einstige Selbstverständlichkeit, so der Autor, hat dieser Begriff längst verloren. Gibt es denn eine andere, eine höhere Wirklichkeit gar als die, der wir tagtäglich begegnen? Und kann der Mensch diesen Erkenntnisweg beschreiten? Voraussetzung dazu sei, so zitiert Müller Rudolf Steiner, sei »die Entwickelung gewisser Erkenntniskräfte«.
Das berührt die Frage nach einer inneren Entwicklung des Menschen, die sich heute nicht mehr auf die früher üblichen Traditionen oder Autoritäten berufen kann, sondern sich "immer voll bewusst und selbstgesteuert vollziehen [soll]. Sie sollte 'Ich-verankert sein'".
Ein individueller Prozess also, der alte Vorstellungen aufhebt und die Möglichkeit bietet, die Anthroposophie als ein "spirituelles Update" zu verstehen: "Es wäre die zeitgemäße Form, den Menschen in seinem Sosein und zugleich in seinen Entwicklungsmöglichkeiten zur Geltung zu bringen." Ein durchaus schwieriges Unterfangen, wie Wolfgang Müller bemerkt: "Warum die Anthroposophie dennoch kulturell weithin ins Leere läuft, wird verständlicher, wenn man sieht, das diese Epoche bislang vor allem eine nach außen gerichtete Aktivität kennt und dass sie dem, worum es Rudolf Steiner geht, einer inneren Aktivität im Grunde hilflos und kraftlos gegenüber steht."
Es war Rudolf Steiner wichtig, zu erklären, warum die Anthropsophie keine, wie man vielleicht heute sagen würde, Wellnessangelegenheit ist, sondern dass es durchaus Arbeit bedeuten könne: » … daß man bei der Geisteswissenschaft nicht bloß das ›Was‹, sondern das ›Wie‹ ins Auge faßt, daß man sich wirklich allmählich bequemt, sich hineinzuleben in Vorstellungen über eine Welt, die nun einmal ganz anders ist als die gewöhnliche physische Welt, und daher auch sich angewöhnt, nach und nach, andere Vorstellungen sich zu bilden, als diejenigen sind, die man sich in so bequemer Weise aus der physischen Welt heraus gebildet hat.«
Es gehe darum, die Wahrheit auszusprechen, »unbekümmert darum, welchen Eindruck sie auf die Menschen macht.«
Steiners Hoffnung auf eine "selbsttragende Weiterführung seiner Impulse" hatte sich nicht erfüllt. Dies mag wohl auch daran gelegen haben, dass er "eigenständigere und kraftvolle Mitstreiter" benötigt hätte. Müller zitiert hier Hans Büchenbacher, den späteren Vorsitzenden der deutschen anthroposophischen Landesgesellschaft, dieser habe es "als ehemaliger Frontkämpfer des Ersten Weltkriegs etwas martialisch ausgedrückt: Wo Steiner Offiziere hätte haben sollen, habe er »bestenfalls Unteroffiziere« gehabt."
Draußen wird von der blinden Autoritätsgläubigkeit der Anthroposophen gefaselt! In Wirklichkeit ist es so, dass ich nur etwas zu sagen brauche, und es geschieht das Gegenteil davon.
Vielleicht, so Müller, hätte es "der anthroposophischen Sache gutgetan, wenn Rudolf Steiner selbst seinen herausragenden Status stärker gebrochen hätte. Unter anderem hätte er, mehr als er es tat, über die komplexen, scheinbar widersprüchlichen Prozesse sprechen können, die ihn zu seinen Einsichten führten."
Was bedeutet Spiritualität in der heutigen, von der naturwissenschaftlich geprägten Zeit? Es ist die Suche nach Wahrheit, die der Autor Müller als die "aktivistische Seite der Anthroposophie" bezeichnet. Nicht mehr das sei leitend, was dem Menschen von außen zukommt, sondern es geht um eine "freie und bewusste Übernahme von Weltverantwortung." Steiner sei davon überzeugt gewesen, "dass Selbsterkenntnis und Welterkenntnis aufs Innigste miteinander verbunden sind. Dies werde naturgemäß erst sichtbar, wenn man »die Selbsterkenntnis im wirklichen Sinne, nicht in dem eines bloßen Hineinstarrens in das ›Innere‹« praktiziere; wenn also das Individuelle in seiner tiefen Weltintegration begriffen wird".
Kritik. damals und heute
Man könnte dieses Kapitel, es ist das Vierte, auch mit "Und täglich grüßt das Murmeltier" überschreiben, denn so alt wie die Anthroposophie ist wohl auch die Diskussion und die Kritik an ihr. Immerhin 58 Seiten umfasst dieses Kapitel und es ist damit das umfangreichste dieses Buches.
Von Beginn an war die Anthroposophie sowohl der völkischen Bewegung wie auch ganz besonders der katholischen und protestantischen Kirche gleichermaßen ein Dorn im Auge. Im Abschlussbericht einer 1922 in Berlin stattgefundener "Konferenz nicht-anthroposophischer Kenner der Anthroposophie" hieß es im letzten Satz: »Es gilt einen Kampf auf Tod und Leben, die Seite wird siegen, die sich vom Heiligen Geist leiten läßt.«
1922 entging Steiner auf einer Vortragsreise in München nur knapp einem Angriff von rechten Störern, der zum Glück glimpflich ausging. Das Presseecho war groß: "… selbst die New York Times berichtete über den Tumult bei Steiners Vortrag. Nach einem weiteren Vorfall (in Wuppertal) hielt Steiner keine öffentlichen Vorträge mehr in Deutschland".
Das Bild der Anthroposophie in der Hitlerzeit, so Autor Müller, sei "ein Bild mit vielen Schattierungen. Sehr leicht lassen sich Belege für beides finden: auf der einen Seite für Anpassung und Anbiederung ans Nazi-Regime und andererseits für eine bewundernswerte Standhaftigkeit und Treue zu den eigenen Überzeugungen; dazwischen alle erdenklichen Abstufungen. (…) Nur hatte Steiner bei alldem stets ein freies Spiel kultureller Impulse vor Augen, niemals ein staatliches oder gar machtstaatliches Programm".
Am 1. November 1935 wurde die Anthroposophische Gesellschaft offiziell verboten, die Waldorfschulen wurden geduldet, bis sie 1941 dann alle geschlossen waren.
Eine einigermaßen unrühmliche Rolle spielten wohl manche Vertreter des biologisch-dynamischen Landbaus, "1933 gründete der bestens vernetzte [Erhard] Bartsch den Reichsverband für biologisch-dynamische Wirtschaftsweise. Dieser stelle sich »rückhaltlos« dem nationalsozialistischen Deutschland zur Verfügung, versicherte Bartsch einem NS-Funktionär. Der Reichsverband wurde Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Lebensreform und war, so eine neue Studie, »die einzige anthroposophische Organisation in Deutschland, die im Zuge der Gleichschaltung Teil einer parteiamtlichen Struktur wurde«."
Auch wenn der dieser Reichsverband 1941 verboten wurde, bestanden weiterhin Verbindungen zwischen Anthroposophie und Nationalsozialismus. Müller: "Das bekannteste Beispiel dafür sind landwirtschaftliche Experimentierfelder, die an das Konzentrationslager Dachau angeschlossen waren. Weleda/Lippert/Kräutergarten und deren Verbindungen zum Regime sind aufgrund einer gerade erschienenden Studie aktuell Thema in vielen Medien". Hier, so unsere (tdz) Empfehlung zur Lektüre des ausgezeichneten Artikels von Jens Heisterkamp in der Zeitschrift Info3.
In anderen anthroposophischen Praxisfeldern ergebe sich jedoch "mitunter ein anderes Bild, teilweise auch mit einer in Anbetracht der Zeitumstände mutigen Resistenz. Dies insbesondere in anthroposophisch geführten heilpädagogischen Heimen für Menschen mit Behinderung. (…) hier aber waren die Gefährdungen existenziell, waren doch genau die hier betreuten Menschen durch das Euthanasie-Programm der Nazis bedroht. Wie es dennoch mit List und Entschlossenheit gelang, diese Heime durch die Hitlerzeit zu manövrieren, ihre Bewohnerinnen und Bewohner soweit es ging zu schützen, beispielsweise auch ihre Sterilisierung abzuwenden und bei Inspektionen jüdische Menschen zu verstecken – das ist ein noch nicht wirklich erzähltes, nur in Einzelstudien verstecktes Kapitel Menschlichkeit."
Verfolgt wurden Anthroposophen wegen ihrer jüdischen Herkunft: "So der Komponist Viktor Ullmann. Seiner Oper "Der Sturz des Antichrist" und vielen von ihm komponierten Liedern lagen Texte des (…) Schriftstellers und prominenten Anthroposophen Albert Steffen zugrunde. (…) Viktor Ullmann wurde am 16. Oktober 1944 nach Auschwitz deportiert und dort ermordet. Seine Opern und viele weitere Werke wurden erst Jahrzehnte nach seinem Tod uraufgeführt."
Müller beschreibt die Entwicklung nach 1945, schildert noch "einen späten Nachhall der Hitlerzeit, etwa als sich herausstellte, dass ein prominenter Priester der anthroposophisch orientierten Christengemeinschaft eine NS-Vergangenheit hatte; er hatte in seiner siebenbürgischen Heimat, damals noch als evangelischer Pfarrer, für die Nazis agitiert".
Würde sich die Spaltung, die 1935 stattgefunden hatte, hier ist zu nennen eine Gruppe um die Ärztin Ita Wegmann, die ausgeschlossen wurde, auflösen lassen? Müller: "Es blieb die Frage, ob nicht die anthroposophische Bewegung im Zuge dieser Vorgänge schwer beschädigt worden war und an Frische und Dynamik verloren hatte".
Das anthroposophische Milieu der 1950er- und 60er-Jahre hätte, so Müller, einen "recht gesetzten Charakter" gehabt: "Was 'draußen' gesellschaftlich vorging, von der antiautoritären Revolte bis zum aufkommenden Feminismus, ganz zu schweigen von der Pop-Kultur, wurde hier allenfalls aus dem Augenwinkel registriert und kritisch beäugt".
Die Biologisch-dynamische Landwirtschaft war im Aufwind, in Herdecke wurde das Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke gegründet, es entstand die Universität Witten-Herdecke und es schien: "dass die seit Steiners Zeiten von der universitären Welt konsequent ignorierte Anthroposophie als Diskurs-Partner ernstgenommen und anerkannt würde".
Ein Überblick über jene Blütezeit kommt natürlich nicht aus ohne jene in Anthroposophenkreisen berühmt gewordene Spiegel-Titelgeschichte des Autors Peter Brügge. Dieser, so der Autor Müller, "schritt im bekannten Spiegel-Duktus (…) das weite anthroposophische Gelände ab, vom »Anthroposophen-Idol Goethe« über »Steiners schwierigen Erkenntnisweg« bis zur Waldorfwelt und zur Eurythmie, insgesamt nicht unfair, aber ohne wirklichen Zugang zur Essenz der Anthroposophie".
Müllers Fazit zu jener Zeit: "Tatsächlich steckt in der Anthroposophie, so schräg und marginalisiert sie bislang im kulturellen Raum steht, ein gewaltiger Anspruch: Sie versucht die Fragen der Zeit aus einer tieferen Schicht heraus anzugehen, nicht von ihren Symptomen, sondern von den seelisch-geistigen Wurzeln her. Entsprechend, so die zutreffende Spiegel-Warnung, kämen die Antworten »von weit her«".
Seit Beginn der 1990er Jahre bestimmen weitere Themen die Debatten über die Anthroposophie und zwar der Vorwurf des Rassismus zum einen und die Behauptung, die Anthroposophie sei unwissenschaftlich. Auf das Thema Rassismus bezogen legt Wolfgang Müller durchaus den Finger in die Wunde: "In der Tat ist es sozusagen kinderleicht, entsprechende Anhaltspunkte in Steiners Werk zu finden". Er versucht jedoch nicht, diese Themen zu umschiffen, sondern benennt einige dieser kritischen Stellen und wird hier eindeutig: "Es sind, in Inhalt und Ausdrucksweise, heute unerträgliche Sätze". Und zu dem von Steiner-Verteidigern oft zitierten Satz: "… ein Mensch, der heute von dem Ideal von Rassen und Nationen und Stammeszusammengehörigkeiten spricht, der spricht von Niedergangsimpulsen der Menschheit" schreibt er: "Zweifelsohne, das ist klar, werden die meisten Menschen sich heute in diesen Fragen nicht mit Jahrtausend-Perspektiven abfinden wollen."
Weiter auf die Auseinandersetzungen mit Kritikern oder Gegnern einzugehen, würde den Rahmen dieser Besprechung sprengen, gleichwohl werden diese Themenfelder von Wolfgang Müller nicht ausgespart. Wie auch die Umstände, die während der Coronapandemie manche Anthroposophen nach Ansicht vieler Kritiker – insbesondere der so genannten Skeptiker-Bewegung – als "Maßnahmen-Gegner" und potentielle Impf-Verweigerer erscheinen ließen: "Die Debatte über sie bekam damit eine neue Drehung, die sich so umschreiben ließe: Die anthroposophische Weltanschauung ist nicht nur etwas seltsam und gewöhnungsbedürftig – sie ist gefährlich; sie durchbricht den Konsens und die Solidarität der Gesellschaft." Die Anthroposophie als Verursacher der »Impflücke«, wie in manchen Medien zu lesen war, nennt Müller "eine groteske These angesichts von vielen Millionen Nicht-Geimpften und nur wenigen Zehntausend Anthroposophen überhaupt."
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es den Leserinnen und Lesern in diesem Kapitel über Kritik und Diskussion ermöglicht wird, sich zu diesem Themenfeld ein eigenes und vielleicht auch ein klareres Bild der Anthroposophie, Rudolf Steiners Gedankenwelt und seine Intentionen zu machen.
Die Anthroposophie kommt als ungeladener Gast in das moderne Leben hinein. Man wird sie erst freundlich behandeln, wenn man bemerkt, daß sie ›Verlorenes‹ bringt.
Ein persönliches Intermezzo
Es folgt mit Kapitel 5 ein kurzes Zwischenkapitel, in dem der Autor seinen persönlichen Zugang zu Steiners Werk schildert. Ein Weg, der bei Spinoza und anderen Geistesgrößen beginnt, sich aber ändert, als er Steiners Werk begegnet. Zwar merkt er an, dass es ihm "… geradezu unangenehm war (…) dass er [Steiner] seine Fokussierung aufs Detail auch aufs Alltägliche ausdehnt, auf Fragen der Lebensführung und der inneren Entwicklung". Inzwischen aber, so meint er heute, dass er "deutlicher zu sehen [meint] in welche Richtung Steiners Ansatz zielt: in Richtung einer gewissenhaften, bewussten, ausgewogenen Arbeit am eigenen In-der-Welt-Sein, an der rechten inneren Verfassung und einer stimmigen Lebenspraxis."
Gleichwohl gibt es aber auch für Wolfgang Müller in Steiners Werk Aussagen, die ihm "ganz fern, fremd, gewöhnungsbedürftig sind, bei denen ich mich praktisch nicht urteilsfähig finde. Die kann ich nur zur Kenntnis nehmen, sie gelegentlich in mir bewegen und vielleicht schauen, ob sich auch hier mit der Zeit manches verdichtet oder eben nicht." Eine Einsicht, die auf die Herangehensweise hindeutet, die auch von Steiner in Bezug auf sein Werk empfohlen wird, nämlich »nichts auf Autorität hin annehmen«.
Der Zeitkritiker Steiner
Beim Lesen des 6. Kapitels kommt dem Rezensenten in den Sinn, wie nahe Steiners Auffassung von Wahrheit im damaligen öffentlichen und publizistischen Raum den Usancen der heutigen Zeit kommt. Steiner: »Die Menschen (…) gehen alle aneinander vorbei. Keiner kennt den anderen. Es kann nicht einmal einer mit dem anderen leben, weil keiner dem anderen zuhört. Jeder schreit dem anderen etwas in die Ohren: seine eigene Meinung, und sagt dann, das ist meine eigene Meinung, das ist mein Standpunkt. Man hat heute wirklich lauter Standpunkte«.
Es gehe aber, so zitiert Müller wieder Steiner, darum, » [sich] immer von verschiedenen Seiten her die mannigfaltigsten Begriffe [zu] bilden«. Allein lebendige Begriffe seien es, die "einer lebendigen Wirklichkeit gerecht werden können" Denn die "Wirklichkeiten" seien niemals statisch, sondern sehr komplex und stets im Wandel begriffen. Der Mensch müsse "geistig in Bewegung kommen", dann sei es möglich, »die in den Tatsachen der Welt wirkende Wahrheit zu empfinden – ich könnte auch sagen, die wirkende Vernunft oder den wirkenden Geist«
Wie es dem Autor Wolfgang Müller gelingt, die Brücke zu schlagen von den Gedanken Steiners vor über 100 Jahren zum Heute, ist beeindruckend, zeigt es doch, dass der Kernsatz, den Steiner seinerzeit formuliert hat, nämlich "das Geistige im Menschenwesen zum Geistigen im Weltall zu führen", nach wie vor seine Gültigkeit hat, auch wenn es für viele Menschen aus den unterschiedlichsten Gründen nicht möglich ist, Steiners Ideen-Kosmos etwas abzugewinnen. Es ziehe sich durch Steiners Werk, so Müller, ein Grundmotiv: »Man kann die Wahrheit in irgendeinem Zeitalter zurückdrängen, aber die Wahrheit kann nicht vollständig unterdrückt werden, aus dem Grunde, weil sie – und das sei jetzt bildlich ausgesprochen – gewissermaßen die Schwester der menschlichen Seele ist«.
Mensch und Technik.
Im Kapitel 7 ist Autor Müller ganz im Hier und Jetzt angekommen; er verweist auf die Macht und den Einfluss der großen Tech-Konzerne, "Hier existieren oder entstehen politisch-technologische Kraftzentren, in denen vergleichsweise kleine Kreise entscheidende Weichen stellen, sei es im Bereich Internet und Künstliche Intelligenz, sei es bei militärischen und Weltraum-Technologien. Der Rest der Menschheit driftet in einen abhängigen Status als Konsument oder Zuschauerin, es entsteht eine Art Techno-Feudalismus". Auch hier verweist Steiner prophetisch auf künftige Entwicklungen: "Interessanterweise sprach Rudolf Steiner immer wieder davon, dass gerade in unserem Zeitalter, das mit seinen demokratischen Tendenzen eigentlich auf eine Streuung von Macht, auf eine breitere Partizipation angelegt ist, die Macht »auf kleine Gruppen übergehen« werde".
Steiner, so Müller, hätte die technischen Entwicklungen seiner Zeit sehr genau verfolgt: "vom Automobil bis zum Grammophon". Und ebenso hätte er Perspektiven angesprochen, die den skizzierten heutigen Bestrebungen nahekämen. Eines Tages werde der Mensch »gewissermaßen seine Intentionen, seine Gedanken hineinleiten können in die Maschinenkräfte«, führte Steiner in einem anderen Vortrag 1917 aus. Und weiter, grundsätzlicher: »Die Zusammenschmiedung des Menschenwesens mit dem maschinellen Wesen, das wird für den Rest der Erdenentwickelung ein großes, bedeutsames Problem sein.«
Auch wenn bei Leserinnen oder Lesern, seien sie nun Anthroposophen oder auch nicht, das Gefühl entstehen könnte, die Kritik Steiners an den damaligen Zeiterscheinungen auf heute übertragen zu können, erteilt Müller ihnen trotz seiner Hinweise auf Ahriman und Luzifer eine Absage. Es gelte eben nicht, "dem kalten »ahrimanischen« Denken der Moderne auszuweichen, sondern es gilt dieses im Formalen, in abstrakten Kausalitäten steckengebliebene Denken zum Substanziellen zu führen, zu ›spiritualisieren‹. Und es gilt nicht die Technik zu verteufeln, sondern gerade an ihr zu einem tieferen Menschsein zu erwachen. Steiner spitzte es bis zu dem Satz zu: »Wirklich, gerade von der Maschine aus wird man den Weg in die spirituelle Welt hinein finden müssen.«". Voraussetzung dazu aber sei, "dass in der Menschheit überhaupt ein Bewusstsein für die Tiefe dieser Auseinandersetzung wächst, dass der Kern, der innere Charakter dieses großen Ringens verstanden wird". Mit Steiner gesprochen, dass »eine genügende Anzahl Menschen dazu in der richtigen Weise vorbereitet ist«.
Fazit und Ausblick
Es zieht sich wie ein roter Faden durch das gesamte Buch von Wolfgang Müller, dass "(…) diese Zivilisation sich in ganz anderen mentalen Mustern [bewegt], die kaum einen Zugang offenlassen zu den Gesichtspunkten, auf die die Anthroposophie hinzuweisen versucht". Diese "Muster" seien allerdings der "aktuelle kulturelle Standard".
Gleichwohl konstatiert Müller in seinem Ausblick: "Rudolf Steiner war immerhin realistisch genug, um zu wissen, dass dieses »kleine Häuflein« mit seiner Überzeugung, der Welt etwas Bedeutendes mitzuteilen zu haben, auf einiges gefasst sein muss: »Mögen uns die Leute auslachen und mögen sie sagen, daß es eine Anmaßung ist das zu glauben; wahr ist es ja doch.«"
Wolfgang Müllers Buch "Das Rätsel Rudolf Steiner" ist einhundert Jahre nach Rudolf Steiners Tod und nach Ansicht des Rezensenten eine gelungene Aufforderung, sich dem Werk Steiners auf eine neue und vielleicht sogar ungewohnte Weise zu nähern. Ohne einen schwärmerischen anthroposophischen "Zauberhauch", ohne Pathos oder sonstwie geartete Sentimentalitäten. Denn: »Wahr ist es ja doch.«
Das Rätsel Rudolf Steiner
Irritation und Inspiration
erschienen im Kröner Verlag
234 Seiten I 25.00 €
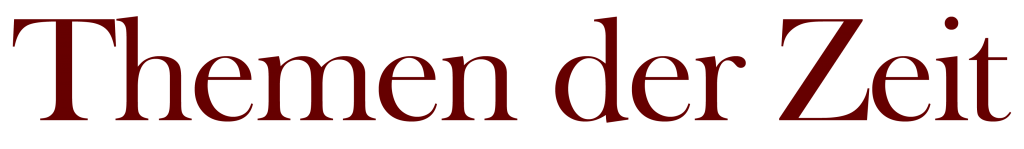
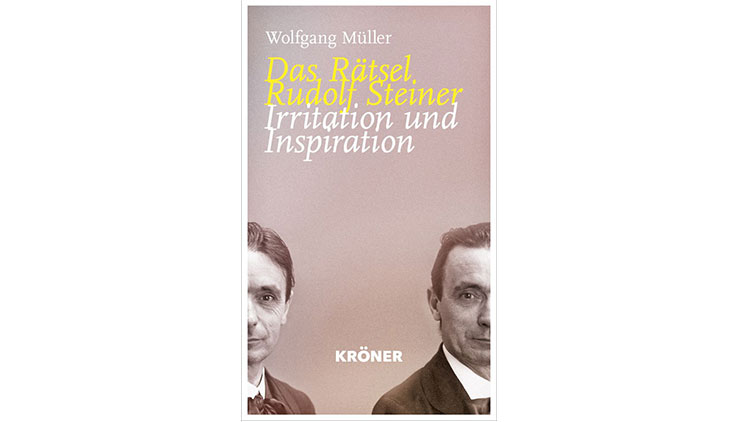
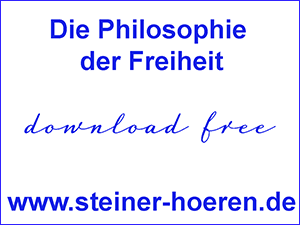




3 Kommentare. Hinterlasse eine Antwort
Für Anfänger vielleicht interessant. Aber viel zu teuer.
Die wahren Geistesschüler lesen den renommierten STIL.
Frau Dr. Haid hat für ihre intimen Schüler den neuesten STIL-Guide in der Schweiz zusammengestellt, das aktuelle Heft heisst «Rudolf Steiner lesen und verstehen» und den Artikel «Menschliche Schöpfung und KI-Kunst» bekommt man kostenfrei.
https://www.anthroposophie.ch/de/kuenste-architektur/news/artikel/aktuelle-entwicklungen-beim-magazin-stil.html
Wir wollen nicht Werbung machen, nicht mal für Rudolf Steiner. Lesen Sie doch lieber Martin Heidegger oder C.G. Jung. Oder Goethe oder Nietzsche. Oder Sophokles oder Euripides. Wirklich, lassen Sie Rudolf Steiner ruhig in Ruhe. Dem geht es prima!
Und noch ein Tipp: Als letztes Buch von Guenther Wachsmuth gibt es seine Übersetzung von «Vril oder Eine Menschheit der Zukunft» immer noch im Verlag am Goetheanum, auch nach über 100 Jahren. Wir haben es also geschafft. Wir sind der Menschheit 100 Jahre lang auf den Keks gegangen damit. Atomkraftwerke kamen. Atomkraftwerke gingen. In Deutschland gibt es keine Atomkraftwerke mehr.
Wenn es dieses kleine Steiner-Erklärheft in 100 Jahren immer noch gibt, dann schauen wir vielleicht mal rein. Es gibt auch noch Stadtbüchereien und Universitätsbibliotheken in Deutschland, nicht nur YouTube und Amazon. Lassen Sie sich ruhig auf etwas Neues ein.
💦 Das Rätsel Rudolf Steiner Alfred Kröner Verlag
💦 Amazon Best Sellers Rank: 305,530 in Books
🔥 Faust Der Tragödie Erster und Zweiter Teil Reclam
🔥 Amazon Best Sellers Rank: 1,881 in Books
🌀 Für ein Rätsel Steiner Buch bekommt man fast vier Exemplare von Goethes Faust
🌀 Goethes Faust gibt es im Internet in wissenschaftlichen Ausgaben und alle wollen das Buch
Meine Mutter zahlt 7,50 Euro im Monat für die Waldorfschule. Wir hatten gehofft Rudolf Steiner wäre wichtiger.