Unser Autor Wolfgang G. Vögele bespricht im Folgenden die neue, im Info3 Verlag erschienene Studie von Albert Schmelzer "Rudolf Steiner im Spannungsfeld von Freiheitsphilosophie, Menschenrechten, Nation und 'Rasse'".
Albert Schmelzer (geb. 1950) ist promovierter Historiker und Professor für Allgemeine Pädagogik an der Alanus Hochschule Alfter. Er hat u.a. zu den Themen interkulturelle Schule, Steiners Dreigliederungsidee und interreligiöser Dialog publiziert.
Schmelzers Studie zum Steiner-Gedenkjahr untersucht, wie sich die Positionen Steiners zu den Themen Freiheitsphilosophie, Menschenrechte, Nation und "Rasse" verhalten. Mit dieser Intention beleuchtet er Steiners Lebensabschnitte in chronologischer Folge und im zeitgeschichtlichen Kontext. Dieser war bekanntlich geprägt von Imperialismus, Nationalismus, der Weltkriegskatastrophe und den revolutionären Umbrüchen am Beginn der Weimarer Republik.
Einleitend stellt Schmelzer das gegenwärtige, ambivalente Erscheinungsbild der Anthroposophie dar: Einhundert Jahre nach Rudolf Steiners Tod seien eine Reihe von Steiners Innovationen in Pädagogik, Medizin und Landwirtschaft gesellschaftlich akzeptiert. Andererseits werden massive Vorbehalte vorgebracht. So hält ein Kritiker die Anthroposophie für eine "elitäre, dogmatische, irrationale, esoterische, rassistische, antiaufklarerische Weltanschauung" (André Sebastiani, Anthroposophie. Eine kurze Kritik. Achaffenburg 2019, S. 164).
Der zeitgeschichtliche Horizont
Das Zeitalter des Kolonialismus zeitigt die oft ambivalenten Ansichten bedeutender Philosophen zu Rassenfragen. Es entstehen der Sozialdarwinismus und die Eugenik ("Rassenhygiene"), aber auch Bewegungen für Menschenrechte und andere emanipatorische Strömungen. Schmelzer stellt klar (S. 53), er befasse sich nicht mit der naturwissenschaftlichen Frage, ob es Rassen gibt, sondern mit der soziologischen, ob Rassismus im Werk Steiners vorliegt oder nicht.
Kindheit und Jugend
Steiners Aufwachsen in bescheidenen Verhältnissen jenseits des Bürgertums begünstigte sein späteres Verständnis für die Sorgen der Arbeiterklasse und für die soziale Frage. Schon früh wurde er für Nationalitätenkonflikte sensibilisiert. Charakteristisch für ihn ist sein Wissensdurst und sein frühes Interesse für mathematische und philosophische Fragen. Parallel dazu trat das Erleben einer übersinnlichen Welt.
Wien
Schmelzer vermerkt Steiners teilweise naiv-schwärmerische Neigung zu "allem Deutschen"
Weimar
Steiner besteht auf dem Primat des Individuums gegenüber der Gattung und dem Kollektiv und begrüßt die Emanzipation der Frau.
Berlin
Menschenrechte seien wichtiger als die Rücksicht auf staatliche Interessen.
Steiner äußert sich als entschiedener Gegner des Antisemitismus. Er bettet seinen Individualismus in die Evolutionstheorie ein und bekennt sich zu einem gewaltfreien individualistischen Anarchismus, abgemildert durch sein Verständnis für die Arbeiterbewegung.
Theosophie
Eine entscheidende biographische Phase, in der Steiner zum Mystiker wird. Ein kontrovers diskutiertes Kapitel der Steiner-Forschung. Er übernimmt theosophische Vorstellungen, erweitert sie durch europäische Spiritualität. Er adaptiert weitgehend die theosophischen Rassenlehren (hierarchisierender Rassismus). Die Aporien zwischen seinem determinierten Geschichtsverständnis und seiner Freiheitsphilosophie bleiben unberücksichtigt.
Aufbauarbeit (1905-1909):
Erste Ansätze zu sozialer, therapeutischer und pädagogischer Wirksamkeit finden bei den Theosophen, die sich vorrangig für Esoterik interessieren, kaum Resonanz.
Nicht der Kampf ums Dasein sei die Triebfeder der Evolution, sondern die gegenseitige Hilfe. Er unterstrich die Friedensaufgabe der TG, die einen Bruderbund zu stiften habe, "ohne Rücksicht auf Rasse, Geschlecht, Farbe und so weiter." Er distanziert sich sukzessive von theosophischen Rassekonzepten und -termini, ersetzt "Rassen" durch "Kulturepochen". Andererseits greift er das Konzept Blumenbachs von den fünf Menschenrassen auf. Dabei wird die "kaukasische" Rasse als die eigentliche Kulturrasse aufgewertet. Die offenkundige Benachteiligung werde durch Reinkarnation in verschiedenen "Rassen" aufgehoben.
Schmelzer vermisst die inhaltliche Stringenz von Steiners oft nur skizzierten Ausführungen.
Auch hier habe dieser die Aporie zwischen dem proklamierten Bruderbund der Theosophischen Gesellschaft und der Abwertung indigener Völker offen gelassen.
Die Jahre 1910-1914
In einem Vortragszyklus von 1910 stellt Steiner die unterschiedliche "Mission" einzelner Völker dar. Dass er dabei von einer Gleichwertigkeit der "Rassen" ausging, stellt Schmelzer aufgrund widersprüchlicher Aussagen in Frage.
Die erste Phase des 1. Weltkrieges (1914-1915)
Steiner kritisiert den Nationalismus, nimmt aber einseitig Partei für die Mittelmächte. Der Krieg sei Deutschland aufgezwungen worden. Dass er In einem Vortrag die weiße Hautfarbe als Zeichen der Spiritualisierung deutet, wird klar als rassistisch bewertet.
Die zweite Phase (1916-1918)
Steiner entwickelt die Idee von der Dreigliederung des Menschen. Seine "Zeitgeschichtlichen Betrachtungen" enthalten Hinweise auf das Wirken okkulter Gruppierungen in den Ententeländern. Aufgrund dieser Hinweise wurde Steiner als Verschwörungserzähler kritisiert. Die Aktivitäten der genannten Gruppen sind später durch Markus Osterrieder (2014) anhand historischer Quellen belegt worden.
Steiner lehnt die Friedensvorschläge Präsident Wilsons ("Selbstbestimmungrecht der Völker") ab, da er einen wachsenden Nationalismus in den einzelnen Ländern befürchtet.
Politischen Entscheidungsträgern in Deutschland und Österreich lässt er Memoranden zukommen, in denen er eine dreifach gegliederte Gesellschaft vorschlägt. In diese Zeit fällt auch seine Äußerung, Rassenideale seien Niedergangsimpulse der Menschheit.
Das Konzept einer Dreigliederung
Seine Schrift "Die Kernpunkte der sozialen Frage" hatte hohe Auflagen und wurde auch bald ins Englische übersetzt. Gelegentliche Behauptungen, dieses Gesellschafts-Konzept sei autoritär und antipluralistisch, hält Schmelzer für unzutreffend. Auch von akademischer Seite (Clement) werde inzwischen bestätigt: Steiner war kein Gegner der Demokratie. Noch 1918 habe er sein freiheitliches und sozial orientiertes Demokratiekonzept spitituell verankert.
Die Dreigliederungskampagne (1919)
Steiners politisches Engagement begann mit seinem "Aufruf an das deutsche Volk und an die Kulturwelt", der prominente Unterzeichner fand. Damit habe sich Steiner einen gewissen Rückhalt im linksliberalen Bürgertum gesichert.
Er habe in einer Zeit starker sozialer Gegensätze versucht, individualistisch-freiheitliche mit sozialistischen Ansätzen zu verbinden und "in Kooperation zwischen Bürgertum und Arbeiterschaft eine reale Perspektive für eine liberale, demokratische und solidarische Gesellschaft aufzuzeigen." Schmelzer zeigt detailreich die verschiedenen Gründe des Scheiterns dieser Kampagne auf, die in Württemberg die Dimension einer hauptsächlich vom Proletariat getragenen Volksbewegung angenommen hatte.
Die Kriegsschuldfrage und weitere gesellschaftspolitische Aktivitäten
Die populäre Dolchstoßlegende wurde von Steiner ebenso zurückgewiesen wie die These von der deutschen Alleinschuld. Er versuchte durch Publikation der Moltke-Memoiren zu verhindern, dass diese These in den Versailler Vertrag aufgenommen wurde. Steiners differenzierte Sicht eines multiplen Ursachengeflechts liege durchaus auf der Linie der gegenwärtigen histotischen Forschung.
Fortan plädierte Steiner für "Musterinstitutionen" im Sinne der sozialen Dreigliederung, von denen jedoch nur die Waldorfschule und die Weleda finanziell überlebten. Ein letzter Versuch im Sinne der Dreigliederung war 1921 die sogenannte Oberschlesien-Aktion, die heftige Angriffe nationaler Kreise auslöste.
Die anthroposophischen Praxisfelder
In den heute noch bestehenden "Praxisfeldern" – von der Waldorfschule bis zur biodynamischen Landwirtschaft – spielten Kategorien wie "Rasse" oder Nation keine Rolle. Aufgrund ihrer allgemein-menschlichen Impulse konnten sie sich international ausbreiten.
Weitere Aktivitäten der letzten Jahre
Aus der Zeit der Neubegründung der Anthroposophischen Gesellschaft (1923/24) liegen einige ambivalente Äußerungen zu "Rassen" (einige in zeitlicher Nähe zum Ruhrkampf) und zum Judentum vor, ohne dass Steiner damit politische Forderungen verband.
Fazit
In einem letzten Abschnitt (Konsequenzen und Ausblick) hält es Schmelzer für unerlässlich, dass sich die Anthroposophische Gesellschaft öffenlich von Steiners Aussagen zu "Rassen" distanziert, da das gesamte Denken in Rassenkategrien überholt sei. Wird damit, so fragt Schmelzer, die Kompetenz des "Geistesforschers" in Frage gestellt?
Schmelzer nennt einige Desiderate der Steiner-Forschung und schlägt Studien vor, die die gängige Auffassung, Steiner habe eine eurozentrische, rein christlich geprägte Weltanschauung vertreten, zumindest modifizieren und die kosmopolitischen Motive stärker aufzeigen könnten. Auch sollten Steiners Beschreibungen indigener Kulturen in Wechselwirkung mit der Ethnologie seiner Zeit näher beleuchtet werden.
Schmelzer polemisiert nicht; in seiner Kritik (etwa an Zander oder Martins) verwendet er moderate Ausdrücke wie "ist ergänzungsbedürftig" oder "ist so nicht haltbar".
Als Fazit von Schmelzers Studie könnte man formulieren: Steiner war ein Kämpfer gegen seine Zeit, aber auch ein Kind seiner Zeit. Es wird deutlich, dass sich wie ein roter Faden durch Steiners gesamtes Werk das Bekenntnis zum Individualismus zieht. Schmelzer hat damit solide Vorarbeit für einen fairen Dialog geliefert, der zwischen Anthroposophen und deren Kritikern stattfinden sollte.
Albert Schmelzer
Rudolf Steiner im Spannungsfeld von Freiheitsphilosophie, Menschenrechten, Nation und ‚Rasse‘.
Frankfurt a. Main: Info3 Verlag, 2025,
336 Seiten, 29,90 Euro.
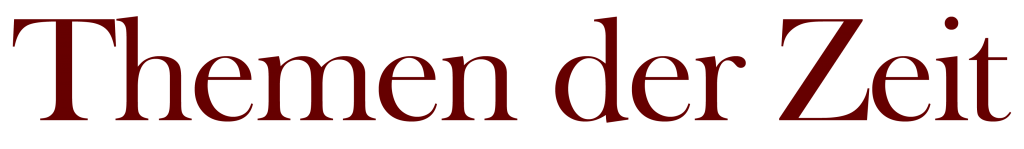
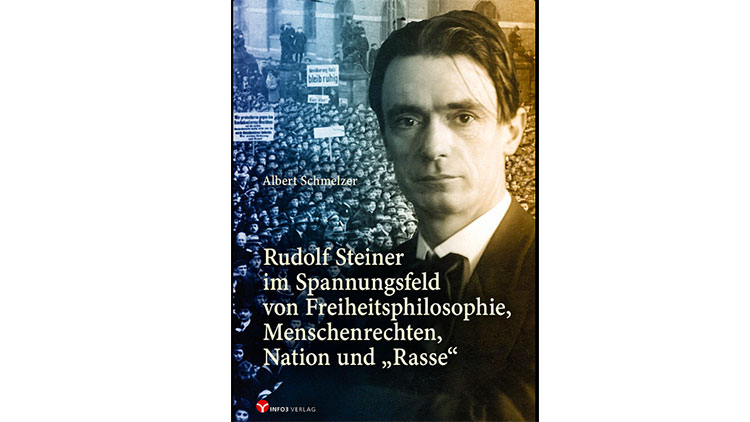
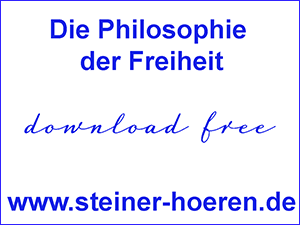




1 Kommentar. Hinterlasse eine Antwort
Vögele: "Er distanziert sich sukzessive von theosophischen Rassekonzepten und -termini, ersetzt "Rassen" durch "Kulturepochen". Andererseits greift er das Konzept Blumenbachs von den fünf Menschenrassen auf. Dabei wird die "kaukasische" Rasse als die eigentliche Kulturrasse aufgewertet. Die offenkundige Benachteiligung werde durch Reinkarnation in verschiedenen "Rassen" aufgehoben."
In Steiners Rassenlehre war sogar die Rede von sieben Menschenrassen (GA 11, 54 und 165). Die semitische und die ursemitische seien die sechste und die siebente. Für diese sieben Menschenrassen hatte Steiner die damaligen Stereotypisierungen verwendet. Die kaukasische Rasse in Europa, Vorderasien und Nordafrika war die "Jupiter-Rasse", die sich aber mit den sog. Sonnenmenschen (theosophisch: "Ursemiten") vermischt und aufgewertet habe.