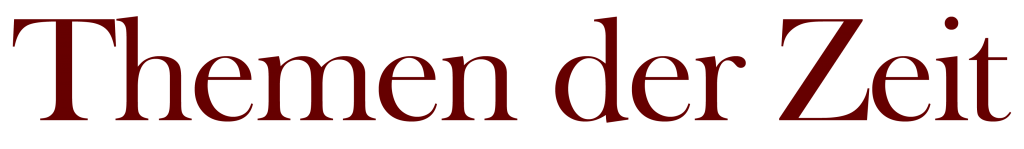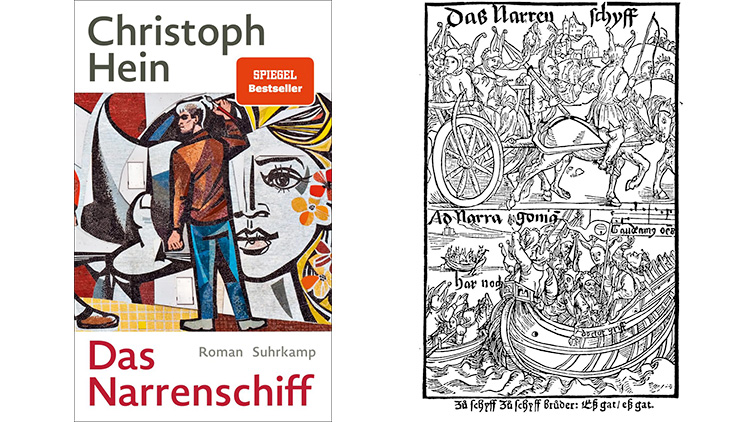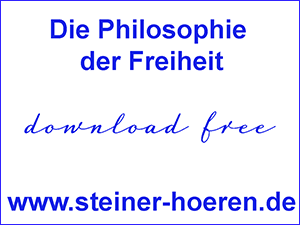Wolfgang Herzberg ist ein ausgewiesener Kenner der DDR-Geschichte. Jetzt hat er eine Rezension von Christoph Heins "Narrenschiff" vorgelegt, die wir gerne bei Themen der Zeit veröffentlichen.
von Wolfgang Herzberg
Das 750 seitige Alterswerk von Christoph Hein, einem der letzten führenden Köpfe der literarischen DDR-Nachkriegsgeneration, der durch seinen Roman "Der fremde Freund" in den 80er Jahren auch über die Grenzen der DDR hinaus bekannt wurde, besteht in dem sehr anspruchsvollen Versuch, die über 40 jährige Geschichte Ostdeutschlands, von der Gründungsphase nach 1945 bis zum Untergang 1989 und sogar etwas darüber hinaus, durch ein vielschichtiges Figurenensemble, überwiegend aus der sogenannten Nomenklatura, exemplarisch zu erzählen, um damit Ursachen für das Scheitern der DDR von Anbeginn an, literarisch zu deuten. Das Buch wurde von einem sehr wohlwollenden Kritiker als "Opus magnum", als ein zusammenfassendes Spätwerk gewürdigt.
Heins grundsätzliche Lesart fasst Steffen Mau auf dem rückwärtigen Cover-Einband so zusammen: "… ein eindrucksvolles historisches Panorama, das sehr gut zeigt, wie man in einen grenzenlosen Opportunismus hineinwachsen konnte." Zugleich ist auf der vorderen Umschlagabbildung des Covers das bekannte bunte Mosaikbild von Walter Womacka "Das Leben" zu sehen.
Heute ist das Monumentalwerk noch am "Haus des Lehrers" am Alexanderplatz zu sehen. Es ist nicht entfernt worden, sondern steht unter Denkmalschutz. Zu Ostberliner DDR-Zeiten wurde ihm der Spitznahmen "Bauchbinde" zuteil.
Dieses Cover ist eine ironische Anspielung auf das schöngefärbte, ideologisch kontaminierte Ideal des "sozialistischen Realismus" der DDR, das mit den erzählten, ambivalenten Wirklichkeitserfahrungen des mehr oder weniger angepassten Personals im Romans wenig zu tun hat.
Die Biografien der teils hohen SED-Funktionäre und ihrer Frauen, auch ihrer Kinder, die im Roman dargestellt werden und zu Wort kommen, reichen von der Ankunft hoher KPD-Funktionäre nach 1945 mit der Gruppe Ulbricht aus der Sowjetunion oder auch aus der westlichen Emigration bis zum Ende der DDR. Ihre wechselnden und mehr oder weniger konformen Haltungen werden entlang von Großereignissen der DDR-Geschichte behandelt: der DDR-Gründungsphase, dem 17. Juni, Stalins Tod, der Geheimrede Chruschtschows über seine Verbrechen 1956, dem Mauerbau, dem 11. Plenum der SED mit dem Verbot von Kunstwerken, dem Prager Frühling, der Ablösung Ulbrichts durch Honecker und schließlich Gorbatschows Bemühungen um Reformen, sowie dem Ende der DDR durch die Massendemonstrationen, aber auch bis in die Anfänge der rüden Abwicklung der DDR durch bundesdeutsche Verhältnisse nach 1989.
Im Mittelpunkt steht nach meiner Wahrnehmung symbolträchtig die Familie von Johannes Goretzka, der einst Nazi-Anhänger war und dann als schwer Kriegsversehrter in der sowjetischen Gefangenschaft von Kommunisten umerzogen wurde, um schließlich auf Ministerebene, als einstiger Maschinenbauingenieur, wenn auch temporär schwerer Fehler bezichtigt, in der DDR doch Karriere macht, um dort führend tätig zu werden. Seine Frau Yvonne, einst Bürohilfskraft, kann sich trotzdem, zunächst durch anfangs widerwillige SED-Mitgliedschaft, zu einer kleinbürgerlichen Kulturfunktionärin und schließlich bis zu einer stellvertretenden Mitarbeiterin im Kulturministerium, der Hauptverwaltung für Kinder und Jugendfilme, emporarbeiten, die diese Filme, je nach dem, kulturpolitisch förderte oder auch zensierte.
Ihre Tochter Kathinka, deren leiblicher Vater, der als Jude aufgrund der Nazizeit kurz vor 1945 noch untertauchen wollte und dann für immer verschollen war, repräsentiert im Roman wohl die schließlich bitter enttäuschte DDR-Nachkriegsgeneration. In einer Schlüsselszene, ganz zu Beginn des Romans, darf sie als ausgezeichnete Schülerin und stolze Pionierin der Pankower "Wilhelm Pieck – Schule" neben dem neu ernannten Präsidenten Pieck sitzen, als die Schule nach ihm benannt wurde. Der Präsident flüstert ihr zu, dass er nie ein so guter Schüler war wie sie, aber Kathinka möge dies bitte keinem weitersagen … Diese, allegorisch erzählte und gemeinte Szene des gemeinsamen Beisammenseins in der Pieck-Schule wird fotografiert und später überall als Ansichtskarte in der DDR vertrieben. Am Ende des Buches zerreißt Kathinka beim Aufräumen nach 1989 das Foto und bricht mit ihrem Mann Rudolf, einem Mathematiker, zu einem Besuch eines ihrer erwachsenen Kinder zu einer Reise ins westliche Ausland auf, nachdem sie und er wohl ganz gut bezahlte neue Arbeitsplätze gefunden haben.
Dieser Familienhintergrund der Familie Goretzka verarbeitet im Übrigen die Lebensgeschichten der leider viel zu früh verstorbenen Frau von Hein, Christiane, und damit auch seine eigenen autobiografischen Erfahrungen in der DDR. Christiane hat lange Jahre, nach ihrem Studium der Philosophie in Leipzig, wo auch Hein zeitweilig studierte, im DEFA-Dokumentarfilmstudio als Redakteurin und später auch als Regisseurin an etlichen Dokumentarfilmen mitgearbeitet, und zwar gar nicht so erfolglos, bis sie nach 1989 zeitweilig arbeitslos wurde, dann aber doch weiter drehen konnte. (s. wiki Christiane Hein).
Porträtiert im Roman wird auch Karl Emser, der als Ökonomie-Professor und später ZK-Mitglied mit der Gruppe Ulbricht aus der Sowjetunion zurückkehrte. Seine Frau Rita ist mit Yvonne, der Mutter von Kathinka befreundet. Emsers zusammenfassende DDR-Erfahrungen lauteten: "Man darf sich irren, aber nie gegen die Partei."
Schließlich spielt auch der homosexuelle Benaja Kuckuck eine wichtige Rolle. Der Remigrant, aus England zurückkehrte Anglist und Germanist bekommt, obwohl international anerkannter Wissenschaftler, nach seiner Rückkehr keine angestrebte Professur an einer Universität, wird aber gegen seinen Willen als Leiter in der Hauptverwaltung Film beim DDR-Kulturministerium eingesetzt und damit schließlich auch zum Vorgesetzten von Yvonne Goretzka, weil die Partei ihn gerade auf diesem Posten als Kulturfunktionär braucht. Nach den Enthüllungen über die Verbrechen Stalins lautet sein resigniertes Credo: " Wer kann an diese Welt noch glauben?"
Dass es diesen im Roman geschilderten, weitverbreiteten Opportunismus auch aufgrund der deutschen Vor- und Gründungsgeschichte der DDR, zumal unter sowjetischer Vorherrschaft sowie der zentralisierten Übermacht des SED-Politbüros gegeben hat, dürfte kaum jemand verwundern und bestreiten. Viele haben das am eigenen Leibe leidvoll an sich selbst und in ihrem Umfeld erfahren. Aber es gab auch, wie bei einigen Personen im Roman angedeutet wird, mehr oder weniger aufrichtige, meist stille Bemühungen, sich trotz Anpassungen eine eigene, kritische Urteilsfähigkeit und auch einen gewissen Selbstbehauptungswillen zu bewahren, wie dies auch dem Autor Hein und seiner Frau im wirklichen Leben gelang.
Es war ein Mitgestaltungswillen, der aber letztlich 1989 den Untergang der DDR auch nicht aufzuhalten vermochte. Dies lag auch daran, weil die materiellen, politischen und kulturell-mentalen Bedingungen bekanntlich nicht nur in der DDR auf Dauer keine historisch tragfähige und überzeugende sozialistische Alternative zum übermächtigen Westen hervorbringen konnte. Es kann dem Autor zugute gehalten werden, dass er die mentalen und politischen Ursachen für das Scheitern des DDR-Sozialismus, im Grunde von Anbeginn an aus seinem stets distanzierten Blickwinkel durchaus zu erfassen versuchte. Aber ich bezweifle, wie einige andere Kritiker auch, dass dieses Buch, übrigens bereits schon mit dem Titel "Das Narrenschiff", in den erzählten inneren und äußeren Grundkonflikten der Figuren wirklich literarisch gelungen ist. Das gesamte Personal und die Handlungsstränge der Figuren im Romans kamen mir an keiner Stelle wirklich künstlerisch nahe. Sie haben mich weder als Romanfiguren psychologisch überzeugt, noch empfand ich ihre Verstrickungen mit den Großereignissen der DDR-Geschichte gelungen. Ich empfand darüber hinaus, dass dies eine sehr einseitige, entfremdete und keineswegs gültige künstlerische Lesart von ostdeutschen Lebens- und Gesellschaftserfahrungen nach 1945 ist und zwar deshalb, weil es die widersprüchlichen, emanzipatorischen Impulse der Lebensgeschichten, die es trotz aller Anpassungen auch gegeben hat, weitgehend ausblendete oder marginalisierte. Der Heroismus und die Tragik dieser Lebens- und Gesellschaftsgeschichten kamen aufgrund mangelnder Empathie für die Figuren des Romans und ihre so gut wie nicht geschilderten sozialistischen Ideale, durch den Autor so gut wie nicht zur Sprache. Das ist aber leider eine angepasste Sicht, die auch der Mainstream gebetsmühlenartig immer wieder ins Spiel bringt, um die DDR-Geschichte und etwaiges ostdeutsches Selbstbewusstsein permanent, als bloße Illusionen und Unrecht, zu delegitimieren.
Wer etwa einmal einen Blick in die zweibändige Ausgabe von "Wer war wer in der DDR" wirft, dürfte dagegen erstaunt feststellen, wie viele der mehr oder weniger dort als namhaft bezeichneten Persönlichkeiten einst aus Arbeiter- Bauernfamilien, aber auch aus jüdischen Familien kamen. Sollten dies überwiegend alles Opportunisten gewesen sein oder könnten darunter auch ein paar aufrechte, kämpferische Sozialisten gewesen sein, die sehr wohl nach der NS-Zeit auch eine befreiende Persönlichkeitsentwicklung durchliefen und keinesfalls nur konforme Karrieristen waren?
Könnte die DDR, so frage ich mich, nicht auch als ein fragiles Schiffchen interpretiert werden, dass sich, trotz wenig kompetenter Mannschaft, doch auf die Suche nach dem "gelobten Land" dem unerforschten Kontinent des Sozialismus machte, aber dabei tragisch unterging, weil die schwierigen materiellen, politischen und mentalen Bedingungen im Ost-West-Kalten Krieg, also außerhalb und in ihrem Schiffchen noch längst nicht günstig waren? Eine solche alternative Lesart der Würdigung von DDR-Geschichte kommt Hein natürlich nicht in den Sinn. Wie übrigens auch wenigen der heutigen Zeitgenossen. Zudem werden dabei die repressiven Anpassungen an heutige Arbeits- und Lebensverhältnisse weitgehend verdrängt, die ich für sehr viel stärker halte als zu DDR-Zeiten.
Reinhard Höppner, nach 1989 SPD – Ministerpräsident in Thüringen, ursprünglich aus der protestantischen DDR – Kirchenbewegung kommend, urteilte bereits früh über diese weitverbreiteten einseitigen Lesarten und gängigen Vorurteile über die DDR-Geschichte: "Die sonst… übliche Frage bei der Bewertung einer historischen Epoche, was trotz schlechter Bedingungen auch positiv geleistet wurde, trat… in den Hintergrund. … da der DDR eine verwertbare politische und kulturelle Substanz völlig fehle, [das] ist eine katastrophale und folgenreiche Fehleinschätzung."
Es handelt sich beim "Narrenschiff" von Hein zugleich um den Versuch einer Adaption des einst populären Buches aus Reformationszeiten "Das Narrenschiff" von Sebastian Brant (1457-1521).
Das Schiff, das sich nach "Narragonien" auf Fahrt begab, beherbergte eine Mannschaft von Narren, wie Habsüchtige, Schwätzer, Ehebrüchige, Grobiane usw. Im Grunde also von "Todsündern", die, aller christlichen Moral spottend, deshalb als inkompetente, lächerliche Narren mit ihrem Schiff untergehen mussten. Und auch ihr "Narragonien" war eine Fata Morgana, das nie wirklich existierte und schon deshalb niemals erreicht werden konnte. Noch dazu mit dieser närrischen Mannschaft. Dies war sicherlich damals eine gelungene Gesellschaftssatire, die die Maske der Scheinheiligkeit von angeblich christlichen Zeitgenossen der Reformationszeit ins Lächerliche zog und vom Gesicht riss. Aber trifft diese Adaption auf das widersprüchliche Bild der DDR-Geschichte wirklich zu? Oder ist diese satirische Zuschreibung, weder für die Mehrheit der SED – Funktionäre, geschweige denn für die Bevölkerungsmehrheit wirklich gültig, sondern der Vogelperspektive eines kritischen Intellektuellen und Autors entsprungen, der einst aus einem Pfarrhaushalt kommend, durchaus verständlicherweise, von Anfang an, mit dem sozialistischen Gesellschaftsversuch fremdelte? Sebastian Brant empfahl am Ende seines Werkes folgende tugendhafte Haltung, die er wohl auch selbst als Autor den Narren und närrischen Verhältnissen gegenüber einnahm: "Er achtet nicht auf das, was der Adel/der Adlige spricht; Oder auf des gemeinen/einfachen Volkes Geschrei; Er ist rund; ganz wie ein Ei, so dass alles an ihm abgleitet"…
Ich möchte am Ende dieser Buchkritik einige Originalaussagen von zwei Arbeiterinnen zitieren, die ich Anfang der 80er Jahre (!) über ihr Leben biografisch befragte und die im Buch "So war es. Lebensgeschichten 1900 bis 1980", Mitteldeutscher Verlag 1984, später auch in der Luchterhand Sammlung 1987, unter dem Titel ""Ich bin doch wer" erschienen sind und dort im Originalwortlaut auch nachlesbar sind. Ich habe dort und auch in späteren Veröffentlichungen Lebenserzählungen dokumentiert, die der Lesart von Hein durchaus nahekamen. Aber mir geht es bei folgenden Zitaten darum, anzudeuten, dass man es sich sowohl in Ost und West, mit der Be- und Verurteilung von DDR-Geschichte und den Biografien darin, nicht zu einfach machen sollte. Annähernd hundert solcher biografischen Interviews habe ich in meinem Berufsleben aufgenommen, insbesondere von Arbeiter- und Arbeiterinnen, auch hohen SED-Funktionären (zusammen mit R. Andert) wie z.B. den Honeckers, sowie Jüdinnen und Juden, die einst in der DDR lebten. Die Tonbänder und Videos wurden zumeist wortwörtlich abgeschrieben, archiviert oder teilweise in meinen Büchern zuvor auch autorisiert und veröffentlicht.
So erzählte eine deutsche Spätaussiedlerin, die erst 1954 nach Magdeburg aus Polen umsiedeln konnte und einst aus einer bettelarmen Familien kommend, dort jahrelang als Magd schuften musste, als sie schließlich in die DDR kam, dann auch Brigadeleiterin und Parteimitglied wurde und zeitweilig ehrenamtlich in einer betrieblichen Konflikt-Kommission und sogar als Schöffin bei Gericht tätig wurde:
"Wie ich (in Magdeburg W.H.) in dem Obst und Gemüsebetrieb anfing, hab ich viel Qualifizierungen durchgemacht, weil ich mich sehr interessiert hab für die Maschinen, die die Gläser und Büchsen verschlossen… Da auf dem Lehrgang musste ich mich auch auf eine Bühne stellen und sagen, was` n Tag über getan werden sollte. Jeder sollte üben, frei zu sprechen, obwohl es erst` n bis `chen Hemmungen gab… Ein schlimmeres und trauriges Leben kann gar nicht gewesen sein, was ich vorher durchgemacht hab. Und darum sag ich ja: Wie ich hierher kam, hat sich für mich ein Schloss auf dem Lande aufgetan. 1957, glaub ich wurde ich das erste Mal als Aktivist ausgezeichnet. Zur Auszeichnung hab ich eine Reise in die Sächsische Schweiz bekommen. .. Wie ich dahin gekommen bin in das Schloss, wo die Könige und die Herren wohnten – da war auch unser Quartier, da haben wir in dem selben Haus geschlafen -, da stand ich manchmal da, da konnte ich es nicht fassen!… Ich sage , vom Ackerbau und Viehzucht in eine Industriestadt – mein ganzer Lebenswandel hat sich verändert! Ich finde gar keinen Ausdruck dafür. Für mich war nur der Betrieb da… Der Wandel in mir kam durch das Weiterstreben…immer weiter, weiter , weiter. Und die Gerechtigkeit, die musste immer mit, da war ich Fanatiker drin, und bis jetzt bin ich nicht schlecht gefahren dabei. Diese Jahre waren sehr lehrreich, sehr abwechslungsreich, man hat viel erlebt, viel mit gelernt und zu gelernt. Hier fing ja erst mein Leben an. Da wusste sich wenigstens, dass ich da bin. Das hat mich jetzt richtig aufgeregt, da hab ich richtige Freude dran!"
Und ihr Fazit über die DDR lautete: "Man soll den Arbeiter- und Bauernstaat mehr achten und schätzen. Man sollte nicht vergessen, was die Namen eigentlich bedeuten. Doch es geht schon manches hintenrum, was nicht mehr Arbeiter- und Bauernstaat ist… ich sprech jetzt so wie ich denke, ob sie es gebrauchen können oder nicht… sie sollen nicht vergessen, dass sie sich alle emporgearbeitet haben, alle von klein angefangen haben, der Arbeiter auch!"
Und eine andere Arbeiterin, die aus einer kinderreichen Familie kam und sich schließlich von ihrem alkoholkranken Mann trennte und als unqualifizierte Frau im Berliner Glühlampenwerk als Laborhilfskraft zu arbeiten begann, erzählte:
"Seit der Glühlampe weiß ich, dass ich lebe, dass ich wirklich lebe, dass ich denken kann, auch sagen kann, was ich möchte. Mein Streben bestand darin: vorwärtskommen, nicht untergehen, nicht drin bleiben in diesem Wums… bloß heute kann ich` s von mir geben. Früher hätten sie keinen Ton aus mir rausgekriegt, da hätte ich mich nicht getraut, aber heute kann ich` s sagen. Ich habe gelernt, selbständig zu sein, was zu unternehmen und auch dafür gerade zu stehen, was man sagt und was man tut. .. Ich habe immer das Gefühl: Du bist doch wer! … Du bist kein so `n unterdrücktes Wesen. Nein!"
Mit folgenden Aussage beendet die einst völlig unpolitische Frau ihre Lebenserzählung:
"Ich wünsche mir Gesundheit und keinen Krieg. Viele haben vergessen, dass sie mal gesagt haben 45: Lieber eine trockne Stulle weniger, aber keinen Krieg mehr. Ich vergeß es nicht, und das sag ich auch heute meinen Kindern… seid genügsamer, aber keinen Krieg. Bloß manchmal sagen sie: Mutter, wie willst du den aufhalten? Ich sage: Na, ich hoffe, dass unsere Regierung sich nicht in Händel einlässt! Das ist meine Hoffnung."
Das Narrenschiff
Christoph Hein
Suhrkamp-Verlag
ISBN-Nr. 978-3-518-43226-6